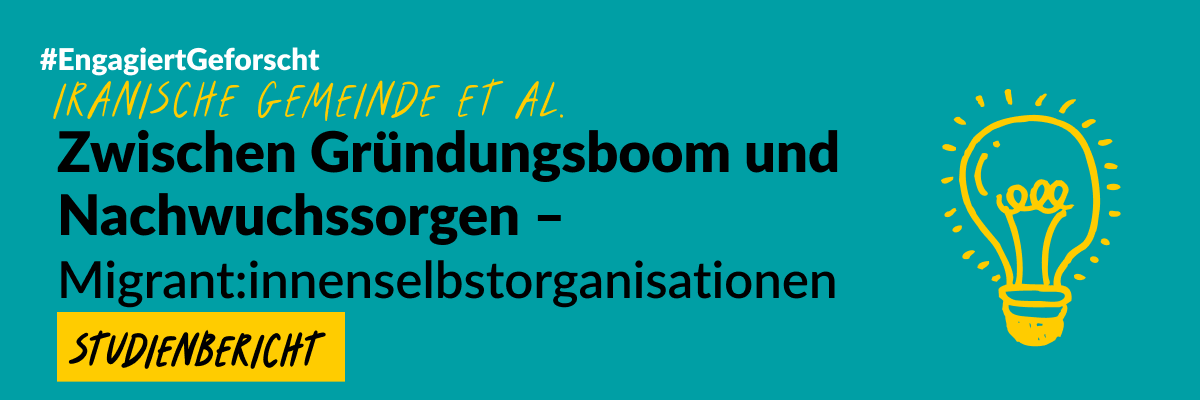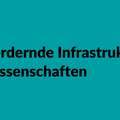Titel der Studie:
Zwischen Gründungsboom und Nachwuchssorgen: Perspektiven und Potentiale einer gelingenden Kooperation zwischen Migrant:innenselbstorganisationen und migrantischen Jugendinitiativen
Personen/Beteiligte Organisationen:
Iranische Gemeinde in Deutschland e. V. (IGD)
Anne-Marie Brack, Vecihe Baris Uyar
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)
djo – Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e. V.
Projektlaufzeit:
April 2022 – Mai 2023
Schlagworte
#Migrantinnenselbstorganisationen #KooperationUndKonflikt #QualitativeForschung
Was haben Sie konkret gemacht / untersucht?
Das Forschungsprojekt „Zwischen Gründungsboom und Nachwuchssorgen“ hat ein Jahr lang vier bundesweit aktive Jugendorganisationen begleitet und die Hindernisse und Potenziale der Kooperation zwischen migrantischen Jugend- und Erwachsenenverbänden analysiert.
Was war Ihr “Aha-Moment”?
„Wenn wir von Unterschieden im intergenerationalen Engagement reden, dürfen wir
nicht nur auf das Alter achten, sondern müssen auch Dimensionen berücksichtigen, wie die Migrationsgeschichte, den gesellschaftspolitischen Zeitgeist, religiöse Aspekte, den Bildungsstand etc. Das macht das Forschungsfeld sehr komplex, aber auch sehr spannend.“ (Vecihe Baris Uyar)
Was sind die drei spannendsten Ergebnisse?
- Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen jungen und älteren Engagierten basieren vielfach auf einem Wissens-, Erfahrungs- oder Ressourcendefizit.
- Ein erfolgreiches generationsübergreifendes Engagement kann gelingen und wird wertgeschätzt. Dafür braucht es aber gute Kommunikationsstrukturen, eine feste Einbindung von Jugendinitiativen in den Migrant:innenselbstorganisationen und selbstbestimmte Strukturen in Jugendinitiativen.
- Junges (post-)migrantisches Engagement hat einen besonderen Wert für unsere Gesellschaft, da sie meistens Vertreterinnen und Vertreter der Nachfolgegeneration die einzigen sind, die das Erbe und die Organisationen selbst am Leben halten können.
Was …
… kann die Politik aus den Erkenntnissen lernen?
Langfristig sollten unabhängige Beratungsstellen geschaffen werden, die Vereine beim Aufbauprozess, beim Neuanfang sowie junges Engagement in ihrer Entwicklung unterstützen. Ebenfalls werden mehr Projekte benötigt, die aktiv (post-)migrantisches Engagement unterstützen und die Zugänge zur Jugendarbeit schaffen.
… können Engagementfördernde Organisationen lernen?
(Post-)Migrantisches junges Engagement findet in einem sehr spezifischen Kontext statt und ist in vielen Bereichen oft unterrepräsentiert und unsichtbar. Für eine diversitätssensible und diskriminierungskritische Engagementlandschaft bedarf es der Partizipation von etablierten Verbänden und Organisationen, die (post-)migrantisches Engagement explizit ansprechen und mitnehmen.
… kann die Wissenschaft lernen?
Das Aktionsfeld von Migrant:innenselbstorganisationen und die Intersektion zwischen Migrationsbezug und Jugend ist in der Forschung weiterhin nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei ist das Feld rund um junges (post-)migrantisches und die intergenerationale Perspektive im Engagement sehr dynamisch und ebenso komplex. Ein besonderer Blick und mehr Forschungsvorhaben in diesem Bereich würden die Perspektiven für postmigrantische Gesellschaften schärfen und auch die Praxis könnte von diesen Ergebnissen profitieren.
Wie geht es weiter?
Das Projekt „Gestärkt engagiert! – Ein Pilotprojekt für (post-)migrantische Jugendinitiativen und ihre Erwachsenenverbände“ baut auf den Ergebnissen dieses Forschungsprojektes auf, wird von der DSEE gefördert und von der Iranischen Gemeinde in Deutschland e. V. durchgeführt. Das Pilotprojekt möchte die Handlungsempfehlungen, die im Forschungsprojekt „Zwischen Gründungsboom und Nachwuchssorgen“ erarbeitet wurden, in der Praxis testen und am Ende eine Toolbox für die Praxis erstellen, auf die Vereine und Engagierte in ihrem Engagementalltag zurückgreifen können. Diese Toolbox wird in Form eines (digitalen) Arbeitsbuches
entwickelt. Dieses Arbeitsbuch enthält praxisnahe und leicht anzuwendende Übungen und Anregungen, die ohne finanzielle oder personelle Ressourcen jederzeit angewandt werden können und Hilfestellung in den ausgewählten Handlungsfeldern bieten, die sich als zentrale Bedarfe in den Forschungsergebnissen herausgestellt haben.