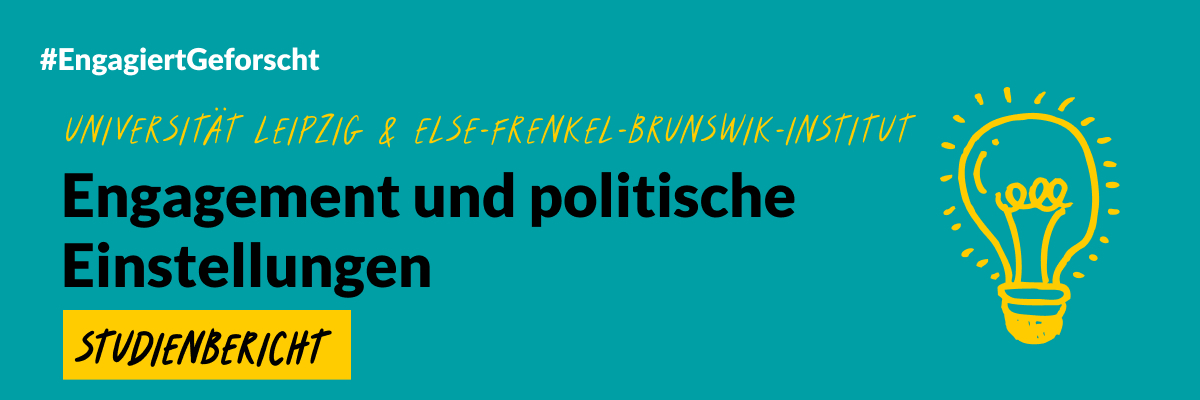Titel der Studie:
Engagement und politische Einstellungen. Herausforderungen und Perspektiven in einer sich wandelnden Gesellschaft
Personen/Beteiligte Organisationen:
Else-Frenkel-Brunswik-Institut (Universität Leipzig):
Hannah Hoffmann, Prof. Dr. Oliver Decker, Prof. Dr. Elmar Brähler
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt:
Dr. Vivian Schachler, Dr. Julia Schlicht
Projektlaufzeit:
Mai 2024 – November 2025
Was wurde konkret gemacht?
Seit 2002 untersucht die Leipziger Autoritarismus Studie im zweijährigen Rhythmus politische Einstellungen in Deutschland. Erstmals wurden im Jahr 2024 auch Fragen zum Engagement aufgenommen. So konnten auf Grundlage einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung Gesellschaftsbilder und politische Orientierungen (z. B. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Autoritarismus, rechtsextreme Einstellungen) mit Bezug zum Engagement ausgewertet werden.
Was sind die drei spannendsten Ergebnisse?
- Die Einstellungen der Engagierten sind deutlich demokratischer als die der Nichtengagierten.
- Engagierte vertreten signifikant seltener rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen als Nichtengagierte.
- Es gibt drei Einstellungstypen von Engagierten – resilient-demokratisch, fragil-demokratisch, rechtsautoritär – die sich zu den Einstellungen auch hinsichtlich ihrer Soziodemographie unterscheiden.
Welche Zahlen sind brisant?
- 95 Prozent der Engagierten stimmen der „Demokratie als Idee“ zu. Das sind signifikant höhere Zustimmungswerte als bei Nichtengagierten (89,5 Prozent).
- Unter den Engagierten vertreten 16 Prozent eine ausgeprägt ausländerfeindliche Einstellung, bei den Nichtengagierten sind es sogar 23 Prozent.
- Engagierte sind mehrheitlich demokratisch eingestellt: 38,5 Prozent lassen sich dem resilient-demokratischen Typus zuordnen, 39,2 Prozent dem fragil-demokratischen Typus und nur 22,2 Prozent dem rechtsautoritären Typus.
Was war ein besonderer “Aha-Moment”?
„Engagement und Ehrenamt sind ein Gewinn für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Studienergebnisse zeigen: Das Erleben eigener Handlungsfähigkeit kann der Politikverdrossenheit entgegenwirken. Um diese Handlungsfähigkeit zu stärken, braucht es stabile Engagementstrukturen, die auch informelle Engagementformen berücksichtigen.“ (Prof. Dr. Oliver Decker)
Was...
… kann die Politik aus den Erkenntnissen lernen?
- In einer Zeit, in der der Druck auf Engagement und Zivilgesellschaft wächst, stehen Engagierte für die Werte der Demokratie ein. Politik muss das Potenzial des zivilgesellschaftlichen Engagements von Einzelnen und Organisationen anerkennen, wertschätzen und zukunftsorientiert fördern.
- Damit der Zugang zum Engagement erleichtert wird, die Beteiligungsbereitschaft steigt und demokratische Teilhabe gefördert wird, sollte die Politik zudem bürokratische Hürden konsequent abbauen sowie langfristige und verlässliche Finanzierung sicherstellen.
… können engagementfördernde Organisationen lernen?
- Organisationen sollten bestehende Strukturen stärken und gleichzeitig neue, informelle Engagementformen gezielt einbeziehen, indem sie Kooperationen eingehen, Zugänge zu Entscheidungstragenden ermöglichen und auch kleine Organisationen und Initiativen dabei einbeziehen.
- Gleichzeitig sollten zivilgesellschaftliche Organisationen auch institutionelle Schutzräume darstellen. Um dies zu ermöglichen, sollten sie Präventions- und Schutzkonzepte gegen rechtsextreme Einflussnahme entwickeln, kommunizieren und in den Organisationen verankern. So bleiben Engagierte handlungsfähig und demokratische Räume geschützt.
… können Wissenschaft und Forschung lernen?
- Engagierte zeigen insgesamt demokratischere Einstellungen. Jedoch wissen wir noch zu wenig darüber, wie sich die unterschiedlichen Einstellungen im Engagement manifestieren.
- Forschungslücken bestehen auch dahingehend, welche Faktoren antidemokratisches Engagement begünstigen, wie groß das Ausmaß rechter Bedrohung in unterschiedlichen Engagementbereichen ist und inwiefern zivilgesellschaftliche Organisationen rechten Interventionen standhalten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Hier geht’s zum Studienbericht (PDF 2 MB).
Hier geht’s zum Kurzbericht (PDF 449 KB).
Hier geht`s zur Pressemitteilung (PDF 564 KB).