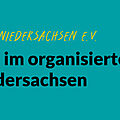Titel der Studie:
GemEINSAMKEIT im Alter: Herausforderungen, Bedarfe und Lebenssituationen betagter Menschen in Laubach, Lkr. Gießen
Personen/Beteiligte Organisationen:
Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Soziologie:
Prof. Dr. Reimer Gronemeyer, Sara Lüttich M. A.
Projektpartner: Stadt Laubach; Landkreis Gießen (Smartes Gießener Land)
Projektlaufzeit:
Juli 2024 – Februar 2025
Was wurde konkret gemacht?
Die Studie hat die Lebenssituation und Bedarfe betagter Menschen in der Kommune Laubach erfasst und analysiert. Mit Hilfe von rund 90 Interviews mit Senior*innen, 13 Interviews mit Expert*innen aus diversen Berufsfelder und teilnehmender Beobachtung bei lokalen Veranstaltungen konnten praxisrelevante Erkenntnisse und konkrete Handlungsvorschläge formuliert werden. Bei der Erhebung standen der Alltag, die Orte, das Engagement und Netzwerke der älteren Menschen im Fokus.
Was sind die drei spannendsten Ergebnisse?
- Soziale Beziehungen sind mindestens genauso wichtig wie finanzielle Ressourcen, wenn es um Lebensqualität und Sicherheit im Alter geht. Es ist also nicht mangelnde Bereitschaft der Senior*innen sich zu beteiligen, sondern unübersichtliche Informationen und organisatorische Hürden.
- Sorge- und Engagementformen im ländlichen Raum sind von informellen, alltagsnahen und beziehungsorientierten Praktiken geprägt. Diese beruhen auf gegenseitiger Unterstützung, emotionaler Nähe und persönlicher Vertrautheit. Das Engagement entsteht dabei nicht durch institutionelle Programme. Dafür braucht es Begegnungsräume, die bereits im Alltag integriert sind.
- Senior*innen sind aktive Mitgestalter*innen des Gemeinwesens, die Brücken zwischen Tradition und Veränderung bauen. Oftmals werden sie aber vor allem als verletzlich und versorgungsbedürftig angesehen. Insbesondere intergenerationale Austauschformate wirken Dynamiken der Vereinsamung entgegen.
Welcher Begriff ist brisant?
“Mikro-Volunteering” kann neue Zugänge schaffen: kurze, flexible Aufgaben im Sinne einer „15-Minuten-Nachbarschaftshilfe“ erleichtern den Einstieg ins Engagement und fördern spontane, alltagsnahe Unterstützung.
Was...
… kann die Politik aus den Erkenntnissen lernen?
- Diversität anerkennen: Verschiedene soziale Lebensbereiche haben unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse und Kapazitäten, die berücksichtigt werden müssen. Außerdem sollten Senior*innen als heterogene Gruppe und aktive Teilnehmer*innen am Gemeinwohl anerkannt werden.
- Infrastruktur schaffen: Engagement und Teilhabe benötigen eine zugängliche Infrastruktur, wie etwa barrierearme Gehwege und Querungen, geschlossene Rad-„Kettenlücken“ und ein Bürgerbus PLUS mit bedarfsgerechter Taktung und sozialen Haltestellen. Insbesondere bei der Vermittlung von Räumlichkeiten sollte unterstützt werden.
- Anerkennung von Engagement: Eigeninitiative, Selbsttätigkeit und freiwilliges Engagement müssen gezielt(er) gefördert und sichtbar wertgeschätzt werden – etwa durch eine Ehrenamts-Card mit alltagsrelevanten Vorteilen.
- Zentrale Anlaufstellen: Es benötigt eine Koordinierungs- und Anlaufstelle, die Informationen bündelt und als zentrale Schnittstelle zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft fungiert.
… können engagementfördernde Organisationen lernen?
- Alltägliche Begegnungsräume schaffen: ältere Menschen wollen sich dort einbringen, wo sie sowieso unterwegs sind im Quartier, am Dorfplatz, beim mobilen Bäcker, im Supermarkt oder in der Kirche.
- Informationen bündeln & Hemmschwellen senken: Nachbarschaftslots*innen können hierbei eine zentrale Brückenfunktion übernehmen. Sie fördern Teilhabe, schaffen Zugänge und vernetzen Menschen, die sonst kaum in Kontakt kommen würden.
Wo finde ich weitere Informationen?
Hier geht’s zum Studienbericht (PDF 7,99 MB).